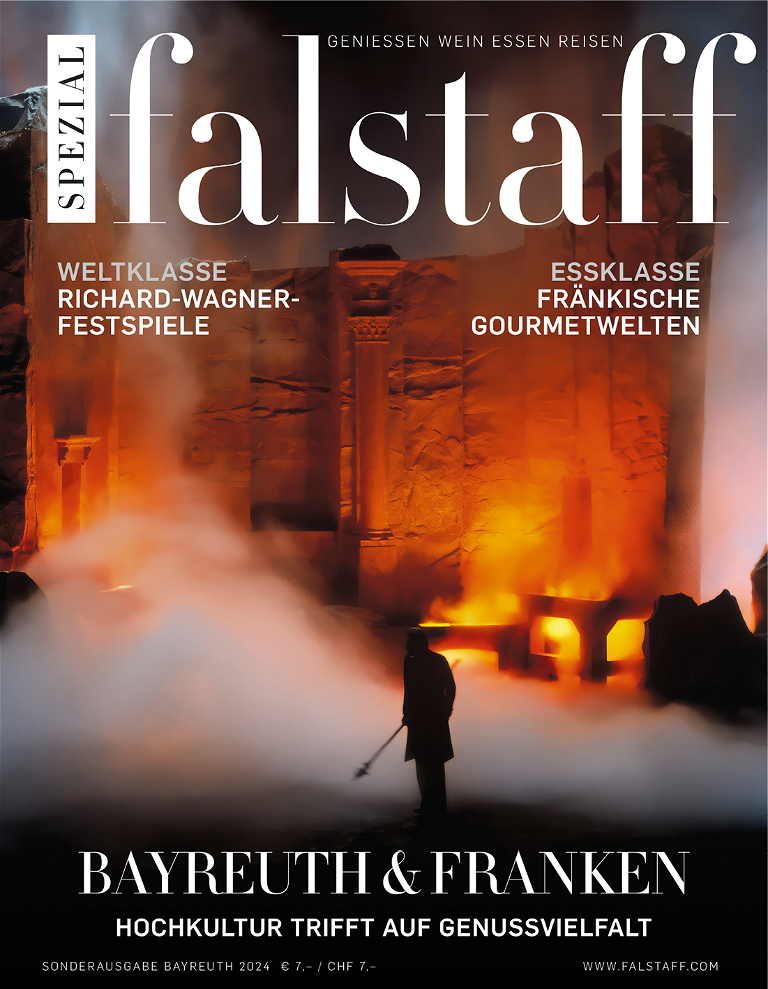Bayreuther Festspiele: Richard Wagner und die Kunst der Kulinarik
Von allem das Beste und davon nicht zu wenig, das war Richard Wagners Lebensmotto. Ob es um Champagner, Austern, Schweinsbraten, Schnupftabak, Stoffe, Beinkleider oder seine Stiefeletten ging, machte da keinen Unterschied. Wo auch immer der Komponist verweilte, überall verprasste er das Geld seiner Gönner. Denn seine eigenen Taschen waren ohnehin leer.
Als Richard Wagner am 28. April 1874 mit seiner Frau Cosima, den Kindern und seinen geliebten Hunden die Villa Wahnfried in Bayreuth bezog, hatte er zum ersten Mal in seinem Leben das Gefühl, endlich angekommen zu sein – und zwar für immer.
1850 war dem Komponisten die Idee gekommen, seinen »Ring der Nibelungen« im Rahmen von Festspielen aufzuführen. Weimar, Würzburg und München erschienen ihm für sein großes Vorhaben geeignet. An das kleine Städtchen in Oberfranken hatte er freilich nicht gedacht. Doch als es ihn 1871 das erste Mal dorthin verschlug, fand er sofort Gefallen an Bayreuth und erkor es zu seiner neuen Wirkungsstätte.
Hier wo mein Wähnen Frieden fand – Wahnfried – sei dieses Haus von mir benannt.
»Es ist mir nötig, endlich zu wissen, wohin ich gehöre, wo ich meinen festen Wohnsitz nehme und für meine Familie im bürgerlichen Sinn sorgen kann«, schrieb er seinem großen Bewunderer König Ludwig II. in der Hoffnung, sein Gönner würde ihm bei seinem Vorhaben – wie schon so oft zuvor – finanziell kräftig unter die Arme greifen. Die Zeilen des Meisters verfehlten die erhoffte Wirkung nicht. Mithilfe einer großzügigen Finanzspritze Ludwigs II. konnte schon ein Jahr später mit dem Bau »eines Hauses, das meiner würdig ist« auf einem Grundstück direkt am Hofgarten begonnen werden.
»Wanderer heißt mich die Welt«
Zwei Jahre später war die Villa Wahnfried bezugsfertig. Wagners Wunsch, endlich angemessen zu residieren, erfüllte sich. »Hier wo mein Wähnen Frieden fand – Wahnfried – sei dieses Haus von mir benannt«, ließ der Komponist auf die Vorderseite der Fassade in goldenen Buchstaben eingravieren.

Aus seinen Worten klang Erleichterung. Schon jahrzehntelang hatte sich der berühmte Künstler danach gesehnt, sesshaft zu werden. Er war es leid, dauernd unterwegs zu sein und nie zur Ruhe kommen zu können. Das kann man verstehen: Der Wagner-Reiseführer »Wanderer heißt mich die Welt« berichtet von über 200 Städten, die der unruhige Geist in fünfzehn verschiedenen Ländern aufgesucht hat. Das Nachschlagwerk »Larousse de la musique« listete sogar 430 Lebensstationen und Wohnorte auf.
VOR DEN GLÄUBIGERN AUF DER FLUCHT
In Würzburg, Königsberg, Riga, Paris, London, Wien, Zürich, Luzern, Breslau, Wiesbaden, St. Petersburg – überall hat der große Musiker Station gemacht. An vielen Orten wäre er gerne länger geblieben, auch weil seine Gesundheit ihm immer wieder sehr zu schaffen machte. Allein sein Hang zur Rebellion und seine Verschwendungssucht durchkreuzten mit verlässlicher Regelmäßigkeit seine Pläne.
1849 musste Wagner etwa seine Bleibe in Dresden Knall auf Fall verlassen, nachdem er sich am Maiaufstand aktiv beteiligt hatte und deshalb steckbrieflich gesucht wurde. Nur mithilfe seines Freundes und späteren Schwiegervaters Franz Liszt gelang es ihm, nach Zürich zu fliehen.
Viel häufiger waren es jedoch die hohen Schuldenberge des Komponisten, die ihn zum plötzlichen Aufbruch zwangen. Unerwartete Ortswechsel, das hatte er schon früh erkannt, waren ein probates Mittel, sich der Rage seiner vielen Gläubiger zu entziehen. Skrupel oder schlechtes Gewissen jenen gegenüber, die ihm Geld geliehen oder sich für ihn sogar verbürgt hatten, waren dem selbstgefälligen Wagner fremd. Wo immer er hinkam, lebte er von Neuem auf großem Fuß. Wer für sein luxuriöses Dasein aufkam, kümmerte ihn wenig, solange er es selbst nicht musste.
CHAMPAGNER IN JEDER LEBENSLAGE
Wenn es allerdings darum ging, ein schönes Mädchen zu verführen, war der Weiberheld durchaus bereit, tief in die Tasche zu greifen, um sein Gegenüber auch mit teuren Delikatessen zu beeindrucken. So war das auch im Jahr 1835, als Wagner gerade als Musikdirektor in Magdeburg tätig war.
dem Punsch glückte, was dem Champagner noch nicht gelungen war
Die Schauspielerin Minna Planer hatte es dem Bonvivant schon länger angetan, doch diese erwiderte sein Werben nicht so, wie von ihm erwartet, berichtet Wagner in seiner Autobiografie »Mein Leben«. »Ich kam deshalb auf den Gedanken, am Silvesterabend die wunderliche Elite unseres Opernpersonals auf meinem Zimmer mit Austern und Punsch zu traktieren.«
Wie erhofft, nahm auch »in großer Unbefangenheit das unverheiratete Fräulein Planer daran teil«. Und zur Zufriedenheit des Gastgebers »glückte dem Punsch endlich, was dem Champagner noch nicht gelungen war. (...) Minna erwiderte ohne alle Scheu meine freundlichen und innigen Zärtlichkeiten.« Ein Jahr später heirateten Wagner und Minna.
Kein Geld in der Hauskasse
Ein besonderes Faible hatte der Gourmet für Champagner: Er trank ihn bei jeder Gelegenheit. Sogar bei einer »Mammutwanderung« auf den Bernina-Gletscher 1853 wollte der begeisterte Bergsteiger darauf nicht verzichten.
»Nachdem wir zwei Stunden lang tief in die Gletscher-Straße hineingewandert waren, musste uns ein mitgebrachtes Mahl mit in den Eisspalten frappiertem Champagner für den schwierigen Rückweg stärken«, schreibt er in seinen Memoiren.
Seiner Vorliebe für das teure Getränk wollte und musste Wagner auch dann nicht entsagen, wenn sich – wie so oft – kein Geld in der Hauskasse befand. Denn sein Freund Paul Chandon de Briailles belieferte ihn großzügig und kostenlos mit Champagner aus dem Hause Moët & Chandon.
BIER ALS MEDIZIN
Noch häufiger als Champagner trank Wagner Bier. Es schmeckte ihm nicht nur außerordentlich gut, Bier war für ihn auch ein Medikament. Als er Ende 1860 unter Erschöpfungszuständen und Fieberschüben litt, empfahl ihm sein Arzt, sich durch ein Beefsteak des Morgens und durch ein Glas bayerischen Biers vor dem Schlafengehen zu stärken. Doch er konsumierte es, wie man in den Tagebüchern seiner zweiten Frau Cosima nachlesen kann, schon »bei der Arbeit« – und natürlich in seiner Freizeit.
In Bayreuth wurde bald die Restauration »Angermann« zum Stammlokal des so geschätzten Meisters. Wagner erschien dort regelmäßig zwischen fünf und sechs am Nachmittag, nahm am Kutschertisch Platz und bestellte einen Krug Weihenstephaner. Das Bier der bayerischen Staatsbrauerei war ihm nämlich das liebste. Auch bei Gesellschaften im Hause Wahnfried wurde immer Weihenstephaner ausgeschenkt.
Bruckner umarmte den Bildhauer daraufhin, küsste ihn und rief: »Herr Hofrat, wie danke ich Ihnen!«
Auch Anton Bruckner kam in den Genuss des süffigen Getränks, als er im September 1875 das hochverehrte Genie in Bayreuth aufsuchte, um untertänigst anzufragen, ob er diesem seine zweite Symphonie in c-Moll oder doch lieber seine dritte in d-Moll widmen dürfe.
Unterhaltung bei gutem Bier
Zuerst wollte Wagner den unbeholfenen Komponisten abwimmeln, berichtet Martin Gregor-Dellin in seiner Wagner-Biografie. Doch als er einen Blick in die Bruckner-Partituren geworfen hatte, schlug seine Stimmung um. Er lud Bruckner ein zu bleiben, um sich bei einem guten Bier mit ihm zu unterhalten.
Zu den beiden Musikern gesellte sich auch der Bildhauer Gustav Adolph Kietz, der gerade dabei war, eine Büste von Cosima Wagner anzufertigen. Zu dessen Überraschung tauchte am nächsten Morgen ein völlig zerknirschter Anton Bruckner auf. Er befände sich in der fürchterlichen Lage, nicht zu wissen, welche der Symphonien, die er geschickt habe, von Wagner ausgewählt worden sei – er habe zu viel Bier getrunken, klagte er Kietz. Er hätte etwas von d-Moll gehört, antwortete dieser. Bruckner umarmte den Bildhauer daraufhin, küsste ihn und rief: »Herr Hofrat, wie danke ich Ihnen!«

OHNE FLEISCH KEIN KOMPONIEREN
Nicht nur bei Champagner, Bier, Punsch und Wein legte Wagner Wert auf höchste Qualität, sondern genauso beim Essen. Und seine Frau Cosima gab sich alle Mühe, den kulinarischen Vorlieben ihres Mannes gerecht zu werden. Dank ihrer französischen Wurzeln standen nicht nur fränkische Hausmannskost, sondern ebenso raffinierte Gerichte aus ihrer Heimat auf dem Speiseplan. Diese ließ sie von einer eigens engagierten Köchin aus Frankreich zubereiten.
Dank Cosimas detaillierter Aufzeichnungen wissen wir, was in der Villa Wahnfried alltäglich, aber auch bei großen Empfängen aufgetischt wurde: Frankenweinsuppe, Wirsing-Frosch, Leipziger Allerlei (ein Gericht aus Wagners Kindertagen), Heringshappen, Krebse, Pfifferlinge in Aspik, Mangold-Quiche, Schinken-Spargel-Röllchen, Bratäpfel mit Vanillesauce oder gefüllte Orangencrêpes fanden sich auf der den Speisekarten der Hausherrin.
Kein Fleisch zu essen, das ist das Ende meines Komponierens
All das schmeckte Wagner allzu gut. Besser gesagt: Er aß mehr, als es seiner Gesundheit zuträglich war. Wenn ihn seine Ärzte wieder einmal dazu mahnten, seinen Appetit zu zügeln, verzichtete er – wenigstens eine Zeit lang – auf Fränkischen Schweinebraten mit Knödeln und Sauerkraut, Schnitzel, Würste und Bratkartoffeln.
Weiße Weste
Apropos Braten und Schnitzel: Immer wieder wird behauptet, Wagner sei ein Vegetarier gewesen. Das war er nicht. Er liebte Tiere und Hunde begleiteten ihn sein Leben lang. Für Spaniel Peps, die Neufundländer Robber und Russ, das Pudelpaar Dreck und Speck und seine Molly scheute der Tierfreund keine Kosten und Mühen. Aber deshalb Fleisch gänzlich von seinem Menüplan zu verbannen, war für den Feinschmecker trotzdem keine Option. Denn ein solcher Verzicht, so hatte er erfahren, hätte sich auf seine Schaffenskraft negativ ausgewirkt: »Kein Fleisch zu essen, das ist das Ende meines Komponierens«, lamentierte er.
Einige Tage habe er ausprobiert, Fleisch zu entsagen, doch schon bald habe er wieder nach Schnitzel verlangt. Zwar sei es Sünde, Tiere zu essen, aber diese Sünde könne man dadurch sühnen, dass man etwas Gutes zustande bringt. Folgt man seiner These, ist Wagners Weste weiß, denn er hat viel Gutes zustande gebracht. Das werden selbst die überzeugtesten Vegetarier dem Schöpfer so großer Werke nicht absprechen können.